EuG verneint Ähnlichkeit zwischen zwei Fantasiefiguren
Rechtsanwältin | Fachanwältin
für Gewerblichen Rechtsschutz
Urteil vom 19. April 2023, Az.: T-491/22
Diesem Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Ein tschechisches Unternehmen hatte am 9. April 2018 die nachstehende Bildmarke

für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 41 im Bereich des Gaming-Sektors als Unionsmarke angemeldet. Gegen diese Anmeldung erhob ein Unternehmen aus Luxemburg Widerspruch hinsichtlich sämtlicher beanspruchter Waren und Dienstleistungen und stützte den Widerspruch unter anderem auf die unter der Registernummer 9 614 868 eingetragene Unionsbildmarke

Die Widersprechende ist der Ansicht, dass zwischen den Vergleichsmarken Ähnlichkeit bestehe und auch die von ihnen erfassten Waren und Dienstleistungen identisch bzw. ähnlich seien, so dass die Gefahr von Verwechslungen für das angesprochene Publikum im Sinne des Art. 8 Absatz 1 b) der Unionsmarkenverordnung (UMV) bejaht werden müsse.
Die Identität bzw. Ähnlichkeit der von den beiderseitigen Marken erfassten Waren und Dienstleistungen war zwischen den Parteien unstreitig.
Streitig war jedoch, ob die oben eingeblendeten Marken ähnlich sind.
Die Widerspruchsabteilung beim EUIPO verneinte eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Zeichen und wies den Widerspruch als unbegründet zurück. Die gegen diese Entscheidung eingelegte Beschwerde wurde von der Vierten Beschwerdekammer zurückgewiesen. Auch die von der Widersprechenden gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer erhobene Klage vor dem Europäischen Gericht in Luxemburg (EuG) blieb ohne Erfolg.
Begründung des Gerichts
Ebenso wie die Widerspruchsabteilung und die Vierte Beschwerdekammer verneinte auch das EuG eine Ähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken sowohl in visueller, klanglicher und in begrifflicher Hinsicht.
Es räumte zwar ein, dass die beiden Marken gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen würden, nämlich einen offenen lächelnden Mund mit Zähnen, große Augen, einen Zylinder, zwei Arme, die in Handschuhen und zwei Beine, die in Schuhen stecken. Zudem seien die Figuren in denselben Farben, nämlich weiß, grau und schwarz gehalten.
Allerdings wies das EuG dann in einem zweiten Schritt auch darauf hin, dass die vorgenannten Merkmale in den beiderseitigen Zeichen unterschiedlich ausgestaltet seien. Zudem seien, abgesehen von dem offenen Mund, auch die jeweiligen Merkmale des „zentralen Elements“ unterschiedlich.
Während die angegriffene Marke zwei weit geöffnete Augen und Augenbrauen aufweise, enthalte die Widerspruchsmarke nur ein Auge, ohne Augenbrauen. Zudem seien auch die Hüte unterschiedlich ausgestaltet. Bei der angegriffenen Marke sei der Hut von durchschnittlicher Größe und nach links geneigt und enthalte den Großbuchstaben „B“. Im Gegensatz hierzu sei der Hut in dem Zeichen der Widersprechenden groß, zur rechten Seite geneigt und enthalte den Buchstaben „S“ oder ein Dollar-Zeichen und einige Banknoten. Unterschiede zwischen den Zeichen seien auch in der Position der Arme und der Beine im Verhältnis zu dem jeweiligen zentralen Element festzustellen. Die angemeldete Marke sei mit geraden Armen und kürzeren Beinen im Verhältnis zum zentralen Körper dargestellt. Hingegen weise das Zeichen der Widersprechenden einen gebeugten rechten Arm und einen linken Arm auf, der auf einem Stock ruht. Auch seien die Beine im Verhältnis zum zentralen Element gleichlang.
Aufgrund dieser deutlich hervortretenden Unterschiede kam daher auch das Gericht zu dem Ergebnis, dass der jeweilige Gesamteindruck der Zeichen so unterschiedlich sei, dass das angesprochene Publikum keine Verbindung zwischen den Vergleichsmarken herstellen werde, auch wenn einige Merkmale eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen würden und die Zeichen in denselben Farben gehalten seien.
Entscheidend sei vielmehr, dass es sich um zwei Fantasiefiguren handelt, die unterschiedlich stilisiert seien, nämlich zum einen ein fröhliches Gesicht in Form eines Balls mit weit-geöffneten Augen, geraden Armen und kurzen Beinen und zum anderen ein einäugiges, leicht deformiertes Gesicht mit einem gebeugten Arm und einem Arm der an einen Stock angelehnt ist, und Beinen die dieselbe Länge wie das zentrale Element aufweisen.
Auch wenn die angesprochenen Verbraucher nicht jedes Detail in Erinnerung behalten würden, werden diese jedoch die Unterschiede in den beiden Zeichen erkennen und somit keine Verbindung zwischen ihnen herstellen.
Zudem könne auch eine phonetische Ähnlichkeit zwischen den Marken nicht bejaht werden. Hierbei wies das EuG zunächst darauf hin, dass Marken, die aus reinen Bildelementen bestehen, phonetisch nicht wiedergegeben werden könnten und folglich auch keine Feststellung zur klanglichen Ähnlichkeit getroffen werden könne. Für den Fall jedoch, dass die Verkehrskreise die auf den jeweiligen Hüten der Vergleichsmarken angebrachten Zeichen als die Buchstaben „B“ einerseits und „S“ oder „Dollarzeichen“ andererseits erkennen und auch aussprechen würden, sei aufgrund der unterschiedlichen Aussprache eine Ähnlichkeit in phonetischer Hinsicht zu verneinen.
Schließlich könne auch eine Ähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht nicht bejaht werden. Der bloße Umstand, dass die Marken mit dem Begriff „Fantasiefiguren“ umschrieben werden können, reiche hierfür nicht aus.
Kommentar
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Ähnlichkeit der betreffenden Marken in Bild, Klang und Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Vergleichsmarken hervorrufen. Bei dieser Beurteilung kommt es entscheidend darauf an, wie die Marken auf das angesprochene Publikum wirken.
Hierbei gilt der im Markenrecht bekannte Erfahrungssatz, dass der Durchschnittsverbraucher* eine Marke in der Regel als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet. Mit dieser Entscheidung wird jedoch nochmals klargestellt, dass dieser Erfahrungssatz nicht bedeutet, dass es für die Bejahung insbesondere der bildlichen Ähnlichkeit ausreichen würde, die in Streit stehenden Marken nur „grob“ zu vergleichen und gewisse Übereinstimmungen festzustellen. Vielmehr sind die einzelnen Elemente der sich gegenüberstehenden Marken genau zu betrachten und sodann zu prüfen, ob der Gesamteindruck, den die eine Marke hervorruft, mit demjenigen Gesamteindruck, den die andere Marke hervorruft, übereinstimmt oder zumindest insoweit Ähnlichkeiten aufweist, die eine Verwechslungsgefahr begründen können.
Zudem führt die Beurteilung der Frage der Ähnlichkeit der Vergleichsmarken in begrifflicher Hinsicht – wie dieser Fall zeigt – insbesondere bei Bildmarken oftmals zu Schwierigkeiten. Dies vor allem dann, wenn der Sinngehalt einer Bildmarke nicht unmittelbar mit einem bestimmten Wort in Verbindung gebracht werden kann. Im vorliegenden Fall hatte die Klägerin vorgetragen, dass die beiderseitigen Zeichen, soweit sie sich Glücksspiele bezögen, von den angesprochenen Verkehrskreisen als „Bingokugeln“ oder „Lotteriekugeln“ aufgefasst würden. Allerdings hatte sie zur Untermauerung ihrer Behauptung keine Beweise vorgelegt, so dass dieses Argument ins Leere lief.
Aber selbst in den Fällen, in denen man mit den zu vergleichenden Bildmarken sofort ein bestimmtes Wort assoziiert, bedeutet dies noch nicht, dass quasi automatisch eine Ähnlichkeit der Zeichen in begrifflicher Hinsicht zu bejahen wäre, denn das Markenrecht kennt einen sog. Motivschutz nicht.
So hatte z.B. die Vierte Beschwerdekammer beim EUIPO mit Entscheidung vom 14. Dezember 2015, Az. R 2234/2014-4, eine Ähnlichkeit und damit auch eine Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Unionsmarke
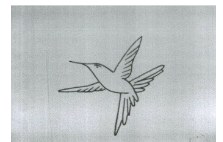
und der älteren Widerspruchsmarke

verneint. Hier war die Kammer der Ansicht, dass die beiden Marken in ihrem maßgeblichen bildlichen Gesamteindruck unähnlich seien. Sowohl die Art der Darstellung, nämlich einerseits eine Zeichnung und andererseits eine scherenschnittartige Silhouette, als auch die Ausführung im Einzelnen würden deutliche Unterschiede aufweisen. Dass beide Marken einen Vogel darstellen, würde noch keine relevante Ähnlichkeit begründen. Einen Motivschutz kennt das Markenrecht nämlich nicht (unter Verweis auf das Urteil des EuGH v. 11.11.1997, C-251/95 – ‚Sabèl‘, Rdr. 26).
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.